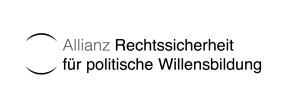Die Beschaffung von Rohstoffen hat derzeit für die Politik weltweit höchste Priorität. Doch der hohe Rohstoffbedarf, der vor allem bei Metallen durch die Digitalisierung und die Energiewende vorangetrieben wird, verschärft die sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Probleme entlang der globalen Rohstofflieferketten. In vielen Ländern und Regionen kommt es durch den Abbau metallischer Rohstoffe zu verheerenden Umweltzerstörungen, der Vertreibung der lokalen Bevölkerung, der Verschmutzung des Grundwassers und lebenswichtiger Flüsse sowie zu Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- und Zwangsarbeit.
Doch wie hoch ist der Rohstoffbedarf eines kleinen Landes wie Baden-Württemberg und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus? Diese Fragen eine wissenschaftliche Studie beantworten, die gemeinschaftlich von Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB), der Werkstatt Ökonomie und dem ifeu-Institut Heidelberg durchgeführt und dem Umweltministerium Baden-Württemberg finanziert wird. Sie soll in einem ersten Schritt einen Überblick liefern über den Rohstoffverbrauch und -bedarf in Baden-Württemberg. Darauf aufbauend soll sie ermitteln, welche Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörungen der Abbau und die Verarbeitung dieser Rohstoffe mit sich bringt. Mit diesen wissenschaftlichen Ergebnissen kann die Studie als Grundlage dienen, um Politik, Unternehmen und die breite Bevölkerung auf die Notwendigkeit einer Rohstoffwende aufmerksam zu machen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Besonders hoher Rohstoffbedarf in BW
Inzwischen sind erste Ergebnisse vorhanden. Während der Materialeinsatz von Metallerzen im Bundesgebiet im Jahr 2021 durchschnittlich bei 1,5 Tonnen pro Person liegt, beträgt er in Baden-Württemberg 3,2 Tonnen pro Person und ist damit, relativ zur Bevölkerung, mehr als doppelt so hoch. Bedingt durch die fortschreitende Energiewende und die Digitalisierung ist in Baden-Württemberg zukünftig eine weitere starke Zunahme von Metallimporten zu erwarten. Metallische Rohstoffe wie Kupfer, Lithium oder Kobalt sind zentral für den Bau von Solaranlagen, Batterien für Elektroautos oder Windkraft. Das zeigt sich in Baden-Württemberg besonders in der Autoindustrie. Diese ist mit einem Umsatz von 31% (2021) des verarbeitenden Gewerbes der mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, gefolgt vom Maschinenbau mit knapp 19%. Während im Jahr 2025 in Baden-Württemberg noch mit 300.000 Neuzulassungen für Verbrenner-Autos und nur 150.000 E-Autos gerechnet wird, sollen im Jahr 2035 die Neuzulassungen für Verbrenner-Autos bei null und die Neuzulassungen für E-Autos bei 400.000 liegen. Für die Batterieproduktion dieser Autos wird dann eine große Menge an Lithium, Kobalt und Nickel benötigt werden. Für die umfangreiche Elektronik wird auch die Nachfrage nach Kupfer stark steigen. Erste Ergebnisse zeigen, dass der Bedarf an Metallen in Baden-Württemberg bereits in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Allein von 2010 bis 2021 hat der direkte Materialeinsatz von metallischen Rohstoffen um 284% zugenommen! Das ist besonders beachtenswert, da die Wachstumsraten anderer Materialkategorien, wie beispielsweise fossile Energien oder nicht metallische Rohstoffe im gleichen Zeitraum nur um 7-8% gestiegen sind.
Doch woher werden wir die hohen Mengen an Rohstoffen beziehen und was bedeutet das für die rohstoffreichen Länder und Regionen? Baden-Württemberg besitzt keine metallischen Rohstoffe und ist auf deren Import angewiesen. Im Vergleich zu 2010 sind die Importe von Metallen um ein Viertel gestiegen. Wichtige Abbauländer von metallischen Rohstoffen sind unter anderem Australien, China und Länder des Globalen Südens, wie Peru, Indonesien, Guinea oder die DR Kongo. Damit zeigt sich eine der zentralen globalen Ungleichheiten: Während Länder im globalen Süden einen Großteil der Rohstoffe abbauen und unter den sozialen und ökologischen Folgen leiden, finden die Wertschöpfung und der Verbrauch bei uns im globalen Norden statt.
Nachdem die ersten Ergebnisse der Studie den überdurchschnittlich hohen und wachsenden Bedarf des Landes an metallischen Rohstoffen aufzeigen, geht es im zweiten Schritt um die Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörungen, die der Abbau und Import dieser Rohstoffe mit sich bringt. Dazu werden Interviews, vor allem mit NGOs, Gewerkschaften und Wissenschaftler:innen aus den Abbaugebieten dieser Rohstoffe geführt. Der Schwerpunkt liegt auf Kupfer, Bauxit, Kobalt, Wolfram und Lithium. Diese Rohstoffe sind im Hinblick auf die Energiewende und die Baden-Württembergische Industrie besonders zentral. Gleichzeitig besteht bei den Metallen eine besonders große Gefahr, dass es im Abbau zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen kommt. Die Interviews sollen entsprechende Auswirkungen und Risiken sowie Lösungsansätze und notwendige Schritte hin zu mehr Rohstoffgerechtigkeit und einer Rohstoffwende aufzeigen. Auch politische Handlungsmöglichkeiten und die Antwort auf die Frage, wie das Land zu einer Rohstoffwende beitragen kann, sollen bearbeitet werden. Was schon jetzt klar ist: Ziel muss es sein, den Rohstoffverbrauch massiv zu senken, den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im Rohstoffabbau und den Lieferketten zu stärken und die Kolonialen Kontinuitäten zu beenden.