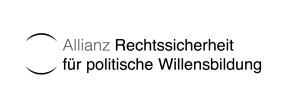Die FfD4-Konferenz (Fourth International Conference on Financing for Development), auch bekannt als “Compromiso de Sevilla“ zielte wie ihre vorangegangenen Konferenzen in Monterrey (2002), Doha (2008) und Addis Abeba (2015) darauf ab, Fortschritte bei der Finanzierung der Agenda 2030 zu erzielen. Die Ergebnisse fallen bescheiden aus, was wenig überraschend ist. Die folgenden Zeilen versuchen die Ergebnisse der Konferenz von Sevilla aus einer panafrikanischen Perspektive zu analysieren.
Symbolik: „Don´t diversify, decolonize!“
Wer die Eröffnungszeremonie der FFD4 verfolgte, dürfte nicht wirklich überrascht gewesen sein. Die offiziellen Reden versuchten, die Relevanz einer Konferenz zu unterstreichen, in die viele Länder des Globalen Südens viel Hoffnung gesetzt hatten, aber deren Vorverhandlungen sich so schwierig gestalten ließen, dass die in Sevilla diskutierten Entwürfe in den meisten relevanten Themen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wurden. Zu Recht kritisierten zivilgesellschaftliche Organisationen und viele Vertreter:innen des Globalen Südens die Dominanz des Globalen Nordens in der Ausgestaltung der Verhandlungsführung. Das von Ländern des Globalen Südens viel kritisierte Top-down-Verfahren hat sich auch im Vorfeld von und in Sevilla durchgesetzt. Dies hat zu einer Marginalisierung der Vorschläge der Länder oder Gruppen des Globalen Südens geführt. So blieben beispielsweise Forderungen nach einer inklusiveren globalen Steuerorganisation unter UN-Mandat ungehört, für die sich etwa die Afrika-Gruppe einsetzte. Stattdessen behält die OECD großen Einfluss in dieser Frage. Unter Berücksichtigung der ernüchternden Gesamtergebnisse von Sevilla fällt auf, dass unter den Redner:innen in der Eröffnungszeremonie und in der ersten Plenarsitzung mit Nigel Clark, dem Stellvertretenden Direktor des Internationalen Währungsfonds, Ngozi Okonjo-Iweela, der Generaldirektorin der WTO und Ajay Banga, dem Präsidenten der Weltbankgruppe drei Personen mit Wurzeln im Globalen Süden zu Wort kamen. Letzterer ist indischer Herkunft, während die zwei ersteren jeweils Finanzminister:in Jamaikas und Nigerias waren. Ihre Präsenz kann fälschlicherweise als entscheidender Schritt zur Verlagerung der Machtverhältnisse zugunsten des Globalen Südens oder zumindest zu dessen Beteiligung an globalen Machtzentren gedeutet werden. Die Präsenz von Personen aus dem Globalen Südens, die diese Institutionen vertraten, ändert per se nichts an deren Logik und Praxis, die ein asymmetrisches System fortsetzen.
Die Redner:innen traten dennoch als Vertreter:innen ihrer jeweiligen mächtigen Institutionen und nicht als Vertreter:innen des Globalen Südens auf. Die Reformforderungen des Südens (z. B. gerechtere Stimmverhältnisse im IWF, globale Strukturpolitik) fanden kaum Widerhall in ihren Aussagen. So blieb die Direktorin der WTO bei einem Appell für ein offenes, regelbasiertes Handelssystem, das armen Ländern Marktzugang und Entwicklungsperspektiven bietet, stehen. Sie wusste wenig Konkretes darüber zu berichten, wie eine Machtverlagerung in der WTO gestaltetet werden kann. Der stellvertretende Direktor des IWF betonte die Notwendigkeit der Systemeffizienz und Stabilität. Wege zu einem strukturellen Wandel zugunsten arm gemachter Länder waren nicht identifizierbar. Der Präsident der Weltbankgruppe sprach von der Notwendigkeit, bestehende Rahmenwerke zu verbessern. Auch bei ihm war eine Auseinandersetzung mit strukturellen Machtverhältnissen nicht erkennbar.
Vor diesem Hintergrund traten diese Institutionen als Hütter:innen bestehender Ordnungen auf, nicht als Architekt:innen einer neuen globalen Handels- und Finanzarchitektur. Sorgfältig anhand der von dominanten Interessengruppen ausgewählte Menschen aus des Globalen Südens in ein derartiges System zu integrieren und somit die Institutionen stellenweise zu diversifizieren, bleibt nur symbolisch, solange das System nicht grundlegend verändert wird. Die kosmetischen Veränderungen dienen lediglich als Ablenkungs- und Verschleierungstaktik für die Verteidigung, Stabilisierung oder Konsolidierung der bestehenden Ordnung oder Unordnung je nach Perspektive. Gegen diese Gefahr eines Tausches der Dekolonisierungs- durch eine so besetzte Diversifizierungsagenda wurde die prägnante Warnung formuliert: „Don´t Diversify, Decolonize“. Sie entstand im Kontext der Bewegung “#RhodesMustFall”, die darauf abzielte, südafrikanische Universitäten und später Universitäten weltweit zu dekolonisieren. Diese Warnung richtet sich gegen eine Diversifizierung, die darauf abzielt, die Benachteiligten eines Systems durch symbolische Repräsentanz emotional zu berühren und zu beruhigen. Es ist zu betonen, dass es hier nicht darum geht, Diversifizierung per se schlecht zu reden. Diversifizierung in der Personalgewinnung im Allgemeinen und in Führungspositionen im Besonderen kann marginalisierten Perspektiven Gehör verschaffen, neue Spielräume öffnen und Veränderungen bewirken. Voraussetzungen dafür sind ein Bewusstwerdungsprozess, eine Professionalisierung und eine gegenseitige Verbündetenschaft, die die marginalisierten Perspektiven vor der Gefahr der Vereinnahmung in die bewährten Praxen oder der Reduktion auf Symbolhandlungen bewahren. Stattdessen würden diese Voraussetzungen dafür sorgen, dass marginalisierte Perspektiven eine institutionelle Einbettung finden. Gelungene strukturelle Veränderungen bedeuten automatisch, dass sich die personelle Zusammensetzung von Gremien und Organisationen automatisch mit verändert. Gegen ein so konzipiertes Diversifizierungsmodell, das dafür sorgt, dass die Pluralität der Wahrnehmungen, Perspektiven und Lösungsansätzen, die es in der Menschheit gibt, zum Vorschein kommt und in der Lösung gemeinsamer Probleme eine Übersetzung findet, ist nichts zu einzuwenden. Für so ein Modell stehen die hier erwähnten internationalen Finanz- und Handelsinstitutionen nicht. Ihre unterdrückerische Logik setzt sich weiterhin trotz der Mitwirkung von Menschen mit Wurzeln im Globalen Süden in ihren Führungsstrukturen fort.
Eine so instrumentalisierte Diversifizierung fördert zwar die Karrieren der Einzelnen aus den Benachteiligten, sie kann dennoch kontraproduktiv sein, indem sie den strukturellen Dimensionen der Benachteiligung ihre Schärfe nimmt und letztendlich systemstabilisierende Dynamiken zwischenmenschlicher Interaktionen schafft. Ein gutes Bespiel solcher Interaktionen gib es bei der WTO, wo die gegenwärtige Direktorin allzu oft die Afrika-Gruppe mobilisiert, sie zu stützen, obwohl die von ihr verfolgte Agenda die afrikanischen Interessen unterminieren. Sie hat beispielsweise die Afrika-Gruppe für die Unterstützung des WTO-Übereinkommen über Fischereisubventionen und der Plurilateralen Initiative zu „Trade Facilitation“, obwohl diese Abkommen die langfristigen Interessen Afrikas nicht schützen. Als Afrikanerin erwartet sie Loyalität von der Afrika-Gruppe nicht, um die afrikanische Agenda (WTO-Reform, Doha-Runde) voranzubringen, sondern um ihres eigenen Erfolges Willen in der Verteidigung der Positionen mächtiger Mitglieder wie die EU, die USA, China und Indien. Die Aufforderung „Decolonize“ nimmt den systemischen Bruch in den Blick und die Überwindung des Unterdrückungssystems. Bezogen auf die Entwicklungsfinanzierung zielt der wachsende Druck des Globalen Südens darauf ab, ein System zu überwinden, das strukturell benachteiligt und tötet und somit dafür sorgt, dass Länder des Globalen Südens die Konsequenzen der etablierten Regeln tragen, die überwiegend vom Globalen Norden diktiert werden. Dass dieses System tötet, zeigt sich daran, dass ein Drittel der Länder Afrikas 40% ihrer Einnahmen für den Schuldendienst verwenden. Für die Zahlungsfähigkeit gegenüber den internationalen Finanzinstitutionen nehmen diese Länder die Zahlungsunfähigkeit gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung in Kauf. Fehlende Investitionen im Gesundheits- und Bildungswesen, in den Arbeitsmarkt und in die Basisinfrastruktur nicht nur kompromittieren die Entwicklungschancen dieser Länder langfristig, sie bedeuten jetzt schon für viele Menschen in arm gemachten Ländern ein Leben in Elend und oft ein früherer Tod.
Ein Handlungsproblem: ambitioniert in der Rhetorik, aber schwach in der Substanz
Die FfD4 wird als verpasste Gelegenheit beurteilt, um die globale Finanzarchitektur gerechter zu gestalten. Alle für Entwicklungsländer brennenden Fragen wurden aufgegriffen: Schuldentragfähigkeit, Klimafinanzierung, Steuertransparenz, prinzipienbasierte Handelspolitik. Die Ungleichheiten im globalen Finanzsystem, die Notwendigkeit von mehr Entwicklungsfinanzierung und Schuldenerleichterung für die Länder des Globalen Südens, ihre stärkere Beteiligung bei internationalen Finanz- und Wirtschaftsfragen sowie eine gerechtere Verteilung von finanziellen Ressourcen zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit sind seit Jahren zentrale Themen der internationalen Kooperation.
Im „Kompromiso“ von Sevilla bleibt es meist bei allgemeinen Absichtserklärungen. Es wurden keine konkreten und verbindlichen Maßnahmen getroffen, die die systematische Machtasymmetrie zwischen Nord und Süd wirksam adressieren. So gab es keine neuen oder verpflichtenden Zusagen zur Erhöhung öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA). Dass die 0,7%-BIP-Zielmarke für ODA erneut ohne konkrete Durchsetzungsmechanismen bekräftigt wurde und dies in einem Kontext, in dem viele Industrieländer und nicht nur die USA ihre ODA-Zahlungen drastisch senken, zeigt, dass es zu einer politischen Kultur geworden ist, leere Versprechungen zu bekunden, um sich in ein gutes Licht zu stellen. Gleiches gilt für das Thema Schulden. Auch hier bleibt es bei Appellen. Das von Ländern des Globalen Südens geforderte multilaterale Schuldenrahmenwerk wurde nicht beschlossen. Was die globale Steuertransparenz angeht, wurden die konkreten Vorschläge zu einer verpflichtenden länderbezogenen Steuerberichterstattung multinationaler Unternehmen deutlich abgeschwächt. Insgesamt blieben die Ergebnisse ohne Substanz. Die seit Jahren von einigen Gruppen aus dem Globalen Süden ausgearbeiteten konkreten Vorschläge zur Reduzierung globaler Ungleichheiten fanden keine Umsetzung.
Fazit: „Entwicklung ist eine Do-it-Yourself-Agenda“
Für den afrikanischen Kontinent hat die FFD4 mehr als die drei Entwicklungsfinanzierungskonferenzen davor gezeigt, dass der Kontinent strategisch agieren muss. Fanden die bisherigen FFD-Konferenzen in einem Kontext statt, in dem die in ihrer Bedeutung von den Gebern überstrapazierte Entwicklungshilfe noch hochgehalten wurde, war der Kontext der FFD4 entscheidend anders. Die Zerschlagung der USAID und die Kürzungen der ODA-Zahlungen vieler anderer Länder zeigen, dass diese Länder in einem von geopolitischen Spannungen geprägten Kontext die Prioritäten anders setzen. Sie reduzieren ihre Entwicklungshilfe oder, wie im Fall der USA, schaffen sie fast komplett ab oder ordnen sie neu ein. Angst, ein Instrument der Soft Power zu verlieren, haben sie anscheinend nicht. Sie vertrauen auf ihre Hard Power. Wo Entwicklungshilfe an Bedeutung und Priorität verliert, ist die Bereitschaft, Kompromisse bei den Kernthemen einzugehen, die die Entwicklungshilfe oft bewusst oder unbewusst verschleiert, noch geringer. Die in Sevilla angekündigten Absichtserklärungen zeigen aus afrikanischer Perspektive, dass es nicht ausreicht, gute Analysen, Forderungen und Vorschläge zu unterbreiten. All dies hat die Afrika-Gruppe an den Tag gelegt. Es reicht auch nicht, gute Argumente oder Strategien bei Verhandlungen zu haben. Auch diese haben sich zumindest einige Länder Afrikas im Laufe der Jahre erarbeitet. Worauf es ankommt, sind Macht- und Kräfteverhältnisse, die Afrika nicht auf seiner Seite hat. Daran zu arbeiten, dies zu ändern, bedeutet „Entwicklung“ nicht als Geschenk von außen, sondern als „Do-it-yourself-Agenda“ (DIY-Agenda) zu begreifen und die notwendigen Schritte einzuleiten, um durch entsprechende handels- und finanzpolitische Ansätze die eigenen Handlungsspielräume zu verbessern. Es geht darum, dass Afrika zu seiner Befreiungsagenda zurückkehrt und sich die Handlungsspielräume verschafft, um dem strukturellen Diebstahl ein Ende zu setzen, die Reparationen für Jahrhunderte Ausbeutung durchsetzt und die Natur seiner Beziehungen zum Rest der Welt verändert.