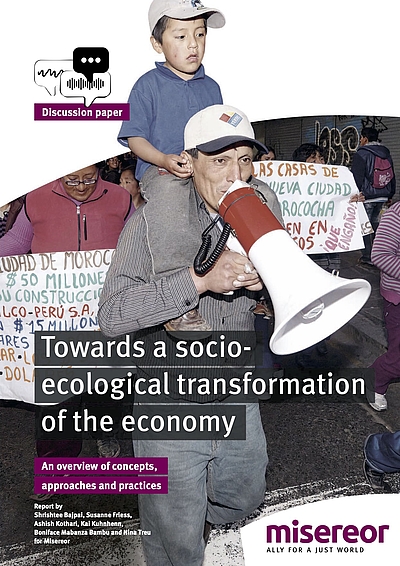Um den Ansatz „Gesellschaft zusammenbringen“ erfolgreich auf lokaler Ebene beginnen und Veränderungen bewirken zu können, braucht es Partner:innen: Menschen in Organisationen, Unternehmen und Institutionen, die sich für das Thema „Faire Regeln“ (gerechte Wirtschaftsordnung) gemeinsam stark machen und ihre Kompetenzen einbringen.
Zentrale Elemente des Ansatzes „Gesellschaft zusammenbringen“ sind:
- Extreme Ungleichheit untergräbt das Miteinander und gefährdet unsere Demokratie. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen z. B. Vermögen extrem ungleich verteilt sind: zwei Familien haben mehr Vermögen als 42 Millionen Bürger:innen. Gleichzeitig sinkt die soziale Mobilität. Das trägt dazu bei, dass der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft zunehmend verloren geht.
- Als Hauptursache für unsere vielfältige, globale Krisensituation sehen wir dominierende wirtschaftliche Mechanismen, die durch liberalisierte Märkte, Wachstums-orientierung und Gewinnmaximierung geprägt sind. Produkte, die Mensch und Umwelt ausbeuten, sind z. B. günstiger, als Produkte, bei denen die Hersteller z. B. auf die Einhaltung der Menschenrechte achten, faire Löhne bezahlen und die Belastung der Umwelt minimieren. Viele Menschen empfinden dies als ungerecht.
- Lösung: faire Regeln (eine gerechte Wirtschaftsordnung), die auf Werten basieren. Sozial-ökologisches Engagement bekommt Vorteile. Dafür gibt es bisher keine fertige Lösung. Damit wir entsprechend der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) Werte als Maßstab für Entscheidungen verwenden können, braucht es gemeinsame Einübung und Kooperation.
- Spürbare, grundlegende gesellschaftliche Änderungen sind weniger vom Verhalten einzelner abhängig, sondern maßgeblich von Änderungen an den Rahmenbedingungen, z. B. Steuersystem, Subventionen, Einkauf und Beschaffung, Handels-politik, Finanzwesen.
- Um die Menschen für grundlegende Veränderungen gewinnen zu können, braucht es zunächst die Vorstellung, wie ein gutes Leben für alle, wie mehr Lebensqualität aussehen kann. Z. B. durch Zeitwohlstand, wertschätzendes Miteinander, Gesundheit, Bildung für ein Miteinander und für Nachhaltigkeit, Freude, Nächstenliebe und Naturverbundenheit, Erhaltung der Schöpfung, eine Grundsicherung - also ein nachhaltiger Lebensstil ohne Stress – lokal, national und global.
- Für ein gutes Leben für alle spielt Suffizienz (Genügsamkeit) eine zentrale Rolle. In seinem Diskussionspapier „Suffizienz als Strategie des Genug“ hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen ausführlich dargelegt, dass Suffizienz (Genügsamkeit) sich sowohl in ökologischer Sicht als auch gesellschaftlich – also auch auf das Miteinander - positiv auswirkt. Ein nachhaltiger Lebensstil, der uns mehr Lebensqualität schenkt, ist nur mit weniger Konsum und mehr Miteinander zu erreichen.
- Um Einfluss auf die Politik als Gesetzgeberin und Gestalterin der Rahmenbedingungen nehmen zu können, braucht es mehr Kooperation und themenübergreifende Praxisbeispiele zwischen den vielen – bisher eher kleinen - Akteur:innen, Organisationen, Unternehmen und Institutionen, die in - bisher eher kleinen - Projekten zeigen und vorleben, wie ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften aussehen kann.
- Gemeinsame Basis für gemeinsames Handeln sind faire Regeln, die wir gemeinsam entwickeln und ausprobieren wollen. Denn mit fairen Regeln (einer gerechten Wirtschaftsordnung) würde sich ein Selbstverstärkungseffekt ergeben, der zu einem sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft führt. Ein konkreter Rahmen für ein gutes Leben für alle, für Mensch und Umwelt, der gleichermaßen auch einen Beitrag zur Erreichung der SDGs aufzeigt.
Der Ansatz wird bisher in Heidelberg als Pilotprojekt umgesetzt.
Beispiel „Bauen und Wohnen“
Faire Regeln (eine gerechte Wirtschaftsordnung) würden uns einladen, so zu handeln, dass alle Menschen einen angemessenen, d.h. auch bezahlbaren, Wohnraum haben. Wohnen ist ein Menschenrecht! Herangehensweise einer gerechten Wirtschaftsordnung (stark vereinfacht) wäre:
- Die Lösung liegt im Wohnungsbestand.
- Ziel ist ca. 40 qm Wohnfläche im Durchschnitt pro Person zu erreichen.
- Ein breiter, öffentlicher Diskurs zu dieser Herangehensweise wäre ein erster, wichtiger Schritt.
- Alle Beteiligten und Mitarbeiter:innen, die mit Bau- und Wohnungsthemen beschäftigt sind (Politik, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Kirchen, Sozialverbände, ...), sind eingeladen, in ihrem Bereich / mit ihrem Team Planungen und Maßnahmen nach diesen Vorgaben umzusetzen. Der zunehmenden Komplexität wird mit Vielfalt, Kooperation und Transparenz begegnet. Für unser Projekt bedeutet es:
GEMEINSAM MACHEN!
Kooperationsmöglichkeiten
Wir suchen weitere Akteure, die diesen Ansatz gemeinsam weiterentwickeln und ausprobieren wollen:
- Welche bestehenden Projekte / Themen können von Ihnen eingebracht werden?
- Welche (neuen) Akteure, Kooperations-Partner:innen, Zielgruppen können eingebunden werden?
- In welchen Städten können weitere Pilotprojekte initiiert werden?
- Weitere Beispiele zu „Faire Regeln (eine gerechte Wirtschaftsordnung) würden uns einladen …“ für verschiedene Themen entwerfen und gemeinsam ausformulieren.
- Welche Projekte / Themen können zu einem themenübergreifenden Praxisbeispiel / Pilotprojekt weiterentwickelt und umgesetzt werden?
- Welche Budgets können beantragt werden? Welche Möglichkeiten finanzieller Unterstützung haben Sie?
Auch freuen wir uns über Ihr Feedback um den Ansatz weiterzuentwickeln.
Projektvorstellung bei ihrer Veranstaltung“:
Sie haben Interesse, dass - bei passender Gelegenheit - das Projekt bei Ihnen vorgestellt oder ein Workshop dazu angeboten wird. Bitte melden Sie sich bei